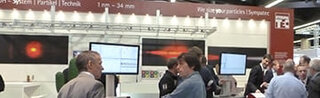Spuren berühmter Besucher
Auf dem heutigen Pulverhaus-Gelände der Sympatec GmbH verschmelzen Kunst und Geschichte in Gestalt eines neuen Skulpturenpfads. Die im August 2025 eingeweihte Installation der Künstlerin Sina Heffner verweist auf das kulturelle Gedächtnis des Ortes. Bereits im 18. Jahrhundert war der Harz ein beliebtes Ziel für Studienreisende aus ganz Europa - angezogen von Naturschönheiten, geologischen Phänomenen und der technischen Raffinesse des Bergbaus. Eine Grubenbefahrung gehörte neben dem Aufstieg auf den Brocken zum Pflichtprogramm vieler Harzreisender.
Die Skulpturen verwandeln die Landschaft in einen Ort der Besinnung und laden die Besucher dazu ein, in die Geschichten der Vergangenheit einzutauchen und gleichzeitig die Schönheit der Gegenwart zu erleben.
Das Konzept des Skulpturenpfads
Die Idee für den ca. 200 Meter langen Skulpturenpfad stammt vom Firmengründer Dr.-Ing. E.h. Stephan Röthele. Der Ausgangspunkt für den Entwurf sind Besuche namhafter Persönlichkeiten, die die ertragreichen Gruben Dorothea und Caroline auf dem heutigen Pulverhaus-Gelände der Sympatec GmbH besichtigten.
Der Entwurf setzt Landmarken in Form von überdimensionalen weißen Federn in die Oberharzer Landschaft. Heutige Besucher gewinnen den Eindruck, sie seien gerade zu Boden geschwebt.
Die Federn erzeugen vielfältige Bilder und Assoziationen und erinnern an die Feder als Schreibwerkzeug: Signaturen an den Federkielen weisen auf die früheren Besucher hin.
Die Feder besitzt eine tiefere Symbolik, die eng mit der Bergbaugeschichte verbunden ist. Früher unterschied man zwischen „Bergleuten von der Feder“ und „Bergleuten vom Leder“. Die „von der Feder” waren Verwaltungsbeamte, die für Planung, Organisation und Dokumentation zuständig waren. Die „vom Leder” hingegen verrichteten körperliche Arbeit unter Tage. Ihren Namen verdanken sie den ledernen Schutzschürzen, die sie bei der Arbeit trugen. Diese historische Rollenverteilung spiegelt sich auch in der Idee der Skulptur wider: Die Feder steht nicht nur für das Denken, Schreiben und Verwalten, sondern würdigt zugleich das Vermächtnis der Menschen hinter den Kulissen, deren geistige Arbeit den Erfolg der Bergwerke mit prägte.
Mit geschwungenen Linien beschreiben die Federn sanfte Bewegungen, die zum visuellen wie träumerisch-gedanklichen Weiterverfolgen einladen. Sie weisen verschiedene Kontraste auf – stellen etwas Kleines in unübersehbarer Größe dar, etwas Flüchtiges, Weiches in einem beständigen, harten Material und in großer Klarheit.
Jede Skulptur ist auf einer Stahlunterkonstruktion aufgebaut und besteht aus Polystyrol und glasfaserverstärktem Kunstharz (GFK). Die Federn variieren in ihrer Größe und sind zwischen 0,70 m und 3,00 m lang und bis zu 2,99 m hoch.
Die Künstlerin - Sina Heffner
Die in Braunschweig lebende Künstlerin Sina Heffner entwickelt Arbeiten in unterschiedlichsten Medien und Materialien. Sie realisiert Kunstwerke im öffentlichen Raum und im Rahmen von Kunst-am-Bau-Projekten. Ihre Arbeiten eint das spezifische Interesse für die Natur, insbesondere das für die Beziehungen zwischen Tier, Mensch und Habitat. Sie erhielt zahlreiche Stipendien und Preise. Einzelausstellungen in Auswahl: Kunstmuseum Tøndern, Dänemark, Museumsberg Flensburg, Naturhistorisches Museum Braunschweig, Kunstmuseum Moritzburg in Halle an der Saale, Palais für aktuelle Kunst Glückstadt.
Berühmte Besucher der Gruben Dorothea & Caroline
Die benachbarten Gruben Dorothea und Caroline erregten bereits im 18. und 19. Jahrhundert internationale Aufmerksamkeit. Zahlreiche Gelehrte, Künstler und Staatsmänner reisten nach Clausthal-Zellerfeld, um die Harzer Bergbauindustrie zu besuchen – und verewigten sich in den sogenannten Fremdenbüchern, den Gästebüchern des Bergwerks Dorothea. Heute gelten diese Bücher als historische Quellen von einzigartigem europäischem Rang.
Zu den berühmtesten Persönlichkeiten, die sich in den Gruben verewigt haben, gehören:
Oberbergrat Wilhelm August Julius Albert (1787–1846) war ein wegweisender Bergingenieur, der maßgeblich zur technischen Modernisierung des Oberharzer Bergbaus beitrug. Nach einem Jurastudium in Göttingen begann er 1806 seine Laufbahn bei den Berg- und Forstämtern in Clausthal und Zellerfeld. 1825 wurde er zum Oberbergrat ernannt und prägte eine Ära bedeutender technischer Innovationen. Besonders hervorzuheben ist seine Erfindung des ersten praxistauglichen Drahtseils, das er 1834 entwickelte und in der Grube Caroline erfolgreich erprobte. Diese Erfindung revolutionierte den Bergbau weltweit, da das industrielle Drahtseil eine deutlich sicherere und langlebigere Alternative zu den bis dahin genutzten Ketten und Hanfseilen bot.
Ab 1836 leitete Julius Albert das Berg-, Hütten- und Forstwesen im westlichen Oberharz. Sein Einfluss reichte jedoch weit über den technischen Bereich hinaus. Er förderte aktiv die Clausthaler Berg- und Forstschule und setzte sich für die Modernisierung der sozialen Absicherung der Bergleute ein, indem er das Knappschaftswesen auf dem Harz unterstützte. Obwohl ihm aufgrund seines bürgerlichen Standes der Titel „Berghauptmann“ verwehrt blieb, wurde er für seine Verdienste weithin anerkannt und mit dem Titel „Oberbergrat mit Obersten-Rang“ ausgezeichnet. Julius Albert gilt als wegweisende Schlüsselfigur des industriellen Fortschritts im Bergbau, dessen Errungenschaften bis in die heutige Zeit spürbar nachwirken.
Nur wenige Namen sind so eng mit dem kulturellen Erbe des Harzes verbunden wie Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832). Als einer der bekanntesten Dichter, Universalgelehrter und Denker Deutschlands hinterließ Goethe mit seinen Besuchen in der Region einen bleibenden Eindruck – sowohl in der Landschaft als auch in seinem literarischen Schaffen.
Goethe bereiste den Harz dreimal – nicht als Tourist, sondern als Forscher mit strategischer Mission. Seine erste Reise führte ihn im Dezember 1777 in die Region. Unter dem Pseudonym “Johann Wilhelm Weber” gab er sich als Maler aus Darmstadt aus. In Wahrheit war er von Herzog Carl August von Sachsen-Weimar beauftragt worden, den Kupferbergbau in Ilmenau wiederzubeleben. Da ihm jedoch das technische Wissen fehlte, begab er sich in den Oberharz, um sich über fortschrittliche Abbau- und Verhüttungsmethoden zu informieren. Seine Befahrungen der Gruben Dorothea und Caroline sowie seine Besuche der damals noch eigenständigen Bergstädte Clausthal und Zellerfeld können daher als frühe Form der Industriespionage angesehen werden.
Goethe kehrte 1783 erneut in den Harz zurück und unternahm 1784 abermals eine Reise in das Mittelgebirge, diesmal in Begleitung seines engen Freundes und Dienstherrn, Herzog Carl August von Sachsen-Weimar. Am 13. August 1784 ist er „zur Caroline eingefahren und zur Dorothea außgefahren“ – ein Erlebnis, das seine Faszination für Bergbautechniken, Mineralien und die einzigartige Harzlandschaft weiter vertiefte. Seine handschriftlichen Einträge im Gästebuch der Grube Dorothea, die bis heute als bedeutende Zeitdokumente überliefert sind, zeugen von seinen Visiten und seiner intensiven Auseinandersetzung mit der Welt unter Tage.
Eines seiner ikonischsten literarischen Werke, Goethes Faust, trägt deutliche Spuren von seinen Harzerfahrungen. Die wilde Berglandschaft, geheimnisvolle Felsformationen und die eindringliche Atmosphäre des Brockens flossen in das Werk ein, verschmolzen Mythen mit Wissenschaft und verliehen dem Harz einen festen Platz in der Weltliteratur.
Goethes Vermächtnis im Harz ist bis heute spürbar. Gedenktafeln, nach ihm benannte Wanderwege und überlieferte Dokumente würdigen seine Besuche, während die Region weiterhin jene anzieht, die – wie einst Goethe – in der Verbindung von Natur, Wissensdurst und Inspiration das Besondere suchen.
James Watt Jr. (1769–1848), Sohn des berühmten schottischen Dampfmaschinen-Erfinders James Watt, zählte zu den bedeutenden Besuchern des Oberharzes im späten 18. Jahrhundert. Am 23. Juli 1786 besichtigte der Ingenieur und Unternehmer die Gruben Caroline und Dorothea. Sein Besuch ist im Gästebuch der Grube Dorothea dokumentiert, wo er schrieb: “The 23. July I went down the Carolina and came up the Dorothea. James Watt from Birmingham England.”
Dieser kurze Eintrag unterstreicht nicht nur das persönliche Interesse von Watt Jr. an der Bergbautechnik, sondern auch die internationale Strahlkraft des Bergbaustandorts Clausthal zur damaligen Zeit.
Im Jahr 1787 begann Watt Jr. sein Studium an der Bergakademie Freiberg, das vermutlich bis 1789 andauerte. Obwohl es nur wenige gesicherte Informationen über seine Studienzeit gibt, gilt es als wahrscheinlich, dass er Vorlesungen bei Abraham Gottlob Werner (Mineralogie, Geologie und Bergbaukunde), Christoph E. Gellert (Chemie und Hüttenwesen) sowie Johann F. Lempe (Physik und Maschinenkunde) besuchte.
Der bedeutende Dichter, Schriftsteller und Journalist Heinrich Heine (1797 - 1856) unternahm im Herbst 1824 eine Wanderung durch den Harz. Vom 14. bis 21. September begab er sich als Göttinger Jura-Student auf eine einwöchige Fußreise, die ihn von Göttingen über Goslar in die Bergbaustädte Clausthal und Zellerfeld, hinauf auf das Brockenplateau und weiter über das mitteldeutsche Tiefland führte. Am 16. September stieg er die schmalen Leitern der Schächte Caroline und Dorothea hinab – ein waghalsiges Unterfangen, das ihn gleichermaßen mit Ehrfurcht wie mit Entsetzen erfüllte. Die dunklen Tiefen, das Schlagen des Eisens gegen das Gestein und das matte Flackern der Grubenlampen offenbarten ihm eine Welt, deren Härte seine städtisch geprägte Vorstellungskraft erschütterte. Am nächsten Morgen, bei Tagesanbruch, trug er sich in das Gästebuch der Dorothea-Grube ein: „H. Heine aus Düsseldorf, stud. juris in Göttingen“.
Diese Erlebnisse wurden zum Herzstück seines Reiseberichts Die Harzreise (1826), der heute als Meilenstein der modernen Reiseliteratur gilt. Heine verwebt darin lyrische Naturschilderungen mit scharfsinniger Gesellschaftskritik. Berühmt ist seine Beschreibung der Grube Caroline als „die schmutzigste Caroline, die ich je gesehen habe”. Seine Reise war weit mehr als eine bloße Besichtigungstour – sie war eine Suche nach Identität und Inspiration, die sich in der rauen Landschaft und der Widerstandskraft der Bergbaugemeinden widerspiegelte, denen er begegnete.
Alfred Nobel (1833–1896), bekannt als Erfinder des Dynamits und Stifter des Nobelpreises, zählt ebenfalls zu den bedeutenden Persönlichkeiten, die den Harz besuchten. Der schwedische Chemiker und Industrielle spielte eine wegweisende Rolle bei der Förderung von Wissenschaft, Technologie und humanitären Idealen.
Weniger bekannt ist jedoch Nobels direkte Verbindung zum Oberharz. Bereits Anfang der 1860er Jahre führte er in der Region Sprengstoffexperimente mit dem hochexplosiven Nitroglycerin durch, wobei die schwierigen Bergbaubedingungen und tiefen Schächte ein ideales Umfeld für die Erprobung und Verfeinerung seiner Innovationen boten. Sein Ziel war es, den Bau von Infrastrukturprojekten wie Straßen, Eisenbahntunneln und Bergwerken zu erleichtern und zu beschleunigen – essenziell in einer Zeit, in der die Industrialisierung in Europa rasant voranschritt.
Doch seine Experimente waren alles andere als ungefährlich: Bei einem Unfall im Jahr 1864 kam sein jüngster Bruder Emil Oskar Nobel ums Leben – ein tragisches Ereignis, das Alfred Nobel zutiefst prägte und ihn weiter anspornte, einen sichereren Sprengstoff zu entwickeln.
Clausthal-Zellerfeld, ein florierendes Zentrum für Bergbaukompetenz, spielte bei seinen Entwicklungen eine Schlüsselrolle. Nobel nutzte aktiv das Wissen und die praktische Erfahrung der lokalen Bergleute, insbesondere derjenigen aus Clausthal, die als die erfahrensten in Europa galten. Schon seit 1632 wurde hier das Sprengverfahren im Bergbau eingesetzt, wodurch sich über Jahrhunderte hinweg ein herausragendes Wissen unter den Harzer Bergleuten entwickelte. Ihre Techniken und Erkenntnisse trugen entscheidend dazu bei, Nobels Verständnis der kontrollierten Sprengung in komplexen Umgebungen zu vertiefen.
Sein Besuch in der Grube Dorothea, einem der renommiertesten Bergwerke Clausthals, war somit weit mehr als eine bloße Exkursion. Es war ein intensiver Austausch zwischen Pionieren der Technik und einer Bergbautradition, die über Generationen hinweg durch praktisches Erfahrungswissen gewachsen war.
Nur wenige Jahre später, im Jahr 1867, wurde Dynamit offiziell patentiert – ein weitaus sicherer, handhabbarer Sprengstoff, der Nitroglycerin in seiner reinen, hochgefährlichen Form ersetzte. Diese Erfindung revolutionierte nicht nur den Bergbau, sondern auch das Bauwesen und die Infrastrukturentwicklung auf der ganzen Welt.
Die Ironie der Geschichte: Obwohl Dynamit später auch militärisch eingesetzt wurde, verstand sich Nobel selbst als überzeugter Pazifist. Die Stiftung des Nobelpreises, wie er sie testamentarisch verfügte, gilt bis heute als sein Vermächtnis, mit dem er wissenschaftliche und friedensstiftende Leistungen ehren wollte – oft interpretiert als Versuch der Wiedergutmachung für die kriegerische Nutzung seiner Erfindung.
Clausthal-Zellerfeld :: Eine Stadt mit Bergbaugeschichte
Clausthal-Zellerfeld war über Jahrhunderte das Zentrum des Oberharzer Bergbaus. Mit der Gründung der Bergakademie Clausthal entwickelte sich der Ort zu einem bedeutenden Standort für Forschung und Innovation. Die international anerkannte Akademie zählt heute zu den ältesten technischen Hochschulen Europas. Diese Tradition führt die Technische Universität Clausthal fort. Bis heute prägt die wissenschaftliche Ausrichtung das Stadtbild – durch Studierende, Forschende und internationale Gäste, die die Stadt lebendig halten.
Die Gruben Dorothea und Caroline – Meilensteine der Technikgeschichte
Die benachbarten Gruben Dorothea (1656–1886) und Caroline (1711–1867) zählten zu den ertragreichsten des Oberharzes. Über Jahrhunderte wurden hier Silber, Blei und Zink gefördert – zugleich dienten sie als Ort technischer Innovation. Vom Einsatz der Wasserkraft bis zu frühen mechanischen Fördersystemen, prägten sie den Fortschritt im Bergbau.
Eine bahnbrechende Erfindung machte 1834 der Clausthaler Oberbergrat Julius Albert, der das erste Drahtseil entwickelte und in der Grube Caroline testete – eine Innovation, die nicht nur den Bergbau weltweit revolutionierte.
Bergbau-Neugier – Ein Muss für frühe europäische Reisende
Bereits im 18. Jahrhundert wurde der Harz zu einem der beliebtesten Reiseziele gebildeter Europäer. Lange bevor der moderne Tourismus Einzug hielt, zog das Mittelgebirge Studienreisende mit ihrer natürlichen Schönheit, Geologie und der hochentwickelten Bergbautechnik an. Neben dem Brockenaufstieg – dem höchsten und sagenumwobenen Gipfel der Region – wurde der Abstieg in einer der vielen aktiven Bergbaugruben des Harzes zu einem wesentlichen Bestandteil jeder rundum gelungenen Reise.
Im hannoverschen Oberharz ermöglichte es die Bergbehörde auch Personen ohne berufliche Verbindung zum Bergbau – den sogenannten Bergfremden – die Bergwerke zu betreten. Solche Bildungsreisen blieben jedoch meist einem kleinen, privilegierten Personenkreis vorbehalten, der sich solche Exkursionen leisten konnte.
An den Grubeneingängen lagen Fremdenbücher bereit, in die sich Besucher vor und nach der Einfahrt eintrugen. Ursprünglich dienten diese Bücher der Sicherheit – im Falle eines Unglücks wusste man, wer sich untertage befand. Doch sie entwickelten sich rasch zu einer Plattform für persönliche Eindrücke: Besucher hinterließen Kommentare, Gedichte oder kleine Zeichnungen – oft direkt nach ihrem Wiederaufstieg aus der Tiefe.
Die Fremdenbücher der Grube Dorothea - historische Quellen von einzigartigem europäischem Rang
Zwischen 1753 und 1886 wurden in der Grube Dorothea insgesamt neun Fremdenbücher geführt, die einen bemerkenswerten Einblick in die damalige Zeit bieten. Sie enthalten über 20.000 Einträge – von Mitgliedern des Adels, Industriellen und Erfindern bis hin zu Gelehrten, Dichtern und Wissenschaftlern. Auch renommierte Persönlichkeiten wie Goethe, Heine, Schopenhauer, Hans Christian Andersen und die Brüder Humboldt verewigten sich darin.
Im Jahr 2017 wurden die Bücher aus der Amtsbibliothek des Landesamts für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) an das Niedersächsische Landesarchiv in Clausthal-Zellerfeld übergeben. Heute gelten sie als historische Quellen von einzigartigem europäischem Rang, die nicht nur die Bergbaugeschichte des Harzes dokumentieren, sondern auch das wissenschaftliche und gesellschaftliche Interesse einer ganzen Epoche widerspiegeln.
Eine der bemerkenswertesten frühen Einträge stammt von Dorothea Schlözer, die im Sommer 1786 mit nur 16 Jahren zu einer geologisch-bergbaukundlichen Studienreise in den Harz aufbrach. Als Tochter eines prominenten Göttinger Professors wurde sie im Alter von 17 Jahren als erste Frau an der Universität Göttingen mit einem Doktorat in Philosophie ausgezeichnet. Ihr Besuch ist auch deshalb bemerkenswert, weil Frauen untertage vielerorts unerwünscht waren – man fürchtete, ihre Anwesenheit bringe Unglück. Die Harzer Bergleute aber zeigten sich in dieser Hinsicht offener, was den besonderen Charakter der Region unterstreicht.
Ein lebendiges Erbe in der Landschaft
Noch heute sind auf dem Gelände der ehemaligen Gruben Dorothea und Caroline Überreste der Schächte, Stollen und der Wasserwirtschaft sichtbar – als eindrucksvolle Zeugnisse eines einzigartigen kulturellen Erbes. Zusammen mit den erhaltenen Fremdenbüchern bilden sie ein faszinierendes Bindeglied zwischen Technikgeschichte und dem kulturellen Austausch, der den Oberharz über Jahrhunderte geprägt hat.
Besuchen Sie den Skulpturenpfad
Am Standort der ehemaligen Gruben Dorothea und Caroline, die einst das Zentrum des Bergbaus in Clausthal-Zellerfeld bildeten, liegt der Skulpturenpfad in einer landschaftlich und historisch bedeutenden Umgebung. Heute gehört das Gebiet zum Pulverhaus-Gelände, auf dem die Sympatec GmbH ansässig ist – ein Ort, an dem der Geist technischer Innovation eine neue Form gefunden hat.
Nur wenige Gehminuten entfernt liegen der Obere und der Mittlere Pfauenteich, zwei Teiche der Oberharzer Wasserwirtschaft. Dieses ausgeklügelte System aus Teichen, Gräben und Wasserläufen wurde im Wesentlichen zwischen 1540 und 1750 zur Energieversorgung des Bergbaus errichtet und ist bis heute in weiten Teilen erhalten geblieben. Seit 2010 gehört es als weltweit ältestes und bedeutendstes vorindustrielles Wasserwirtschaftssystem zum UNESCO-Weltkulturerbe. Erleben Sie einen Ort, an dem Kunst, Geschichte und Technik auf besondere Weise miteinander verschmelzen.
Der Skulpturenpfad „Spuren berühmter Besucher“ lädt Sie ein, innezuhalten, nachzudenken und zu staunen – über die Vergangenheit, die Gegenwart und jene federleichten Spuren großer Persönlichkeiten.
Geöffnet: ab August 2025, frei zugänglich